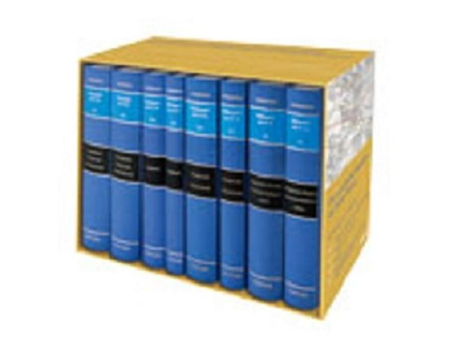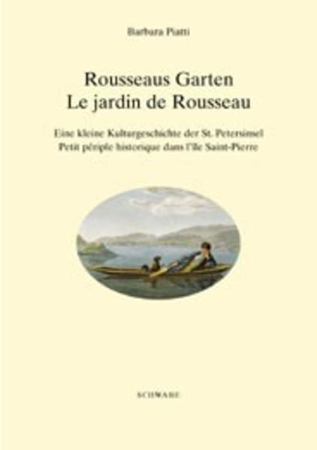schwabe
Die griechische Geisteswelt hat sich in Abhängigkeit vom Alten Testament entwickelt, wobei die Offenbarung mitunter verfälscht wurde - so die Sicht der Kirchenväter. Diese historische Erklärung des Befunds stützte ihre Methode im Umgang mit der antiken Kultur, die darauf zielte, die Elemente des Wahren aus der Verbindung mit Falschem abzulösen und in den Dienst des Evangeliums zu stellen. Die Nichtachtung dieser Methode beobachteten sie im Mißbrauch der Philosophie seitens der Irrlehren. Sie ist - unabhängig von jener zeitbedingten Erklärung des Befunds - bedeutsam für das Problem der sogenannten Inkulturation.
Groß ist die Fülle an Ratgeberliteratur für Hochsensible. Was bislang fehlte, ist eine philosophische und kulturkritische Beleuchtung des Phänomens. Das Buch liefert zum einen eine phänomenologische Beschreibung der verschiedenen Dimensionen der Lebensrealität hochsensibler Personen, die durch autobiographische Erfahrungen der selbst hochsensiblen Autorin Authentizität erlangt. Zum anderen werden zentrale ethische Fragestellungen reflektiert: Können Hochsensible überhaupt glücklich werden in einer lauten und hektischen Welt, in der ein flexibler, belastbarer und wettbewerbsfähiger Mensch als Norm gilt? Müssen sie sich an die modernen Lebens- und Arbeitsbedingungen anpassen, oder sollten nicht umgekehrt diese aus Gründen der Gerechtigkeit umgestaltet werden - wodurch sie vermutlich für alle menschenwürdiger wären? Das Buch gibt Anstöße zur Reflexion über das eigene Leben und gesellschaftliche Wertmaßstäbe. «...eine gut lesbare multiperspektivische Analyse des Phänomens der Hochsensibilität, die herausfordert zu einer dringend notwendigen Debatte der bislang vernachlässigten sozialethischen Dimension des gesellschaftlichen Umgangs mit Andersheit.» (Prof. em. Dr. Annemarie Pieper)
Sinnfragen sind aufdringlich. Sie lassen sich weder abweisen noch kleinreden. Tagtäglich müssen Entscheidungen getroffen werden, die nach einer situations- und normgerechten Lösung verlangen. Dabei tauchen auch grundsätzliche, nämlich die eigentlich philosophischen Fragen auf: Wie kann ich ein selbstbestimmtes Leben führen, ohne meine sozialen Verpflichtungen zu vernachlässigen? Hat der Körper ein Mitspracherecht bei der individuellen Lebensgestaltung? Welche Rolle spielt das Geschlecht in Bezug auf Strategien zur Konfliktbeseitigung? Wie sähe eine Welt aus, in der Sinnfragen überflüssig geworden wären? Annemarie Pieper gibt in ihrem neuen Buch in zwölf Texten Denkanstösse zu diesen und weiteren wichtigen philosophischen Fragen.
In seinem letzten Lebensjahr publizierte der Zürcher Universalgelehrte Conrad Gessner (1516-1565) die Studie De rerum fossilium, lapidum et gemmarum maxime, figuris et similitudinibus liber, die Steine und andere res fossiles aufgrund einer Ähnlichkeit im Aussehen oder der Bedeutung ihres Namens zu Bereichen der Natur und zu Artefakten in Beziehung setzt. Die Verwendung von Holzschnitten zur Illustration stellt auf dem Gebiet der Erdwissenschaften eine Innovation dar. Die für die Forschung verschiedener Disziplinen wichtige Schrift wird in dieser Ausgabe erstmals aus dem Lateinischen übersetzt, in ihren historischen Kontext eingeordnet und durch Zitatnachweise und Register erschlossen. Der Sammelbegriff res fossiles verweist auf das, was sich aus dem Boden ausgraben lässt: Gesteine, Minerale, Erze sowie Fossilien im heutigen Sinn, die man damals meist nicht als Relikte von Organismen erkannte. Das «Fossilienbuch» zeichnet sich durch zahlreiche Holzschnitte aus, die Objekte aus den Sammlungen von Gessner und seinen Korrespondenzpartnern zeigen. Es dokumentiert den Austausch von Informationen und Bildmaterial und gibt Einblick in Gessners internationales Netzwerk. Mit Beiträgen zur Einleitung von Urs B. Leu und Walter EtterErstellung der Register unter Mitarbeit von Alessandra Geiger
Erfahrungen, gute wie schlechte, motivieren immer wieder zum Nachdenken über die grossen Welt-rätsel. Sie erschüttern aber auch die dabei gewachsenen Einsichten. Unruhe durchzieht Philosophie, genährt von zwei Fragen: Wieviel braucht eine Philosophie, die der Sinnspur menschlichen Lebens nachgehen will? Und wieviel Erfahrung verträgt sie? (Helmut Holzhey)
Die Autosuggestion nach Emil Coué ist eine verblüffend einfache Anwendung, die bis heute unzähligen Menschen geholfen hat. Dank ihr lassen sich Schmerzen lindern, Blockaden lösen und scheinbar hoffnungslose Situationen über das Unbewusste in uns selbst in positives Erleben wenden. Dieses Buch bietet eine Einführung in die Methode der bewussten Autosuggestion und liefert Beispiele für ihre Behandlungserfolge.
Spielregeln für eine pluralistische Gesellschaft Der vorliegende Essay wirbt für ein gelassenes Verhältnis zwischen Religion und moderner Gesellschaft. Als Vorbild dienen die Wissenschaften. Diese haben sich im Lauf ihrer Geschichte von weltanschaulichen Fundierungen gelöst. Es gibt heute keine jüdische Physik oder christliche Biologie. Darum sind Wissenschaftler auch weltanschaulich frei. Ob ein Chemiker oder ein Arzt ein Jude, ein Christ oder ein Atheist ist, spielt für das fachliche Know-how keine Rolle. Diese Gelassenheit ist bedroht. Grund ist die «weltanschauliche Polarisierung», wie sie Jürgen Habermas vor einigen Jahren beschrieb. Auf der einen Seite breiten sich naturwissenschaftliche Weltbilder aus, in denen die Menschen zu unpersönlichen Objekten atomisiert werden, auf der anderen Seite wächst die Zahl religiöser Extremisten, die ihren persönlichen Glauben zu einem Maßstab für alle Menschen machen. Beide Tendenzen gefährden gemeinsam unsere bewährte Rechtsordnung. Auf dem Spiel steht unsere Meinungs- und Glaubensfreiheit, unsere gesellschaftliche Vielfalt. Die Polarisierung erweist sich nicht nur als eine Bedrohung für unsere individuelle Freiheit. Sie verdeckt auch die elementare Bedeutung der Religionsfreiheit für pluralistische Gesellschaften. Diese sind weder mit dem Wunsch nach einem Gottesstaat noch mit dem Wunsch nach einer religionsfreien Zivilgesellschaft vereinbar. Michael Rüegg behandelt dieses Thema im Spannungsfeld von Wissenschaft, Religion und Politik zum einen im Rückgriff auf 'klassische' Positionen, u.a. von Hans-Georg Gadamer, Peter Strawson und Richard Rorty, zum anderen in der kritischen Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Autoren wie Thomas Metzinger, Alain de Botton, Peter Sloterdijk oder Byung-Chul Han.
Helmut Holzhey blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Als Kind durchlebte er den Zweiten Weltkrieg; mit 16 wurde er von der DDR-Staatssicherheit verhaftet und verhört; er musste nach Westberlin flüchten. Sechs Jahre später führte ihn sein Theologiestudium nach Zürich. Hier zog ihn seine Leidenschaft für die grossen Fragen von der Theologie zur Philosophie - ein langer Weg zur Professur begann. In dieser Autobiographie fällt immer auch Licht auf die wichtigen politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen der Nachkriegszeit: Holzhey erlebte hautnah die revolutionäre Aufbruchsstimmung der 1960er Jahre und die angespannte Lebenssituation im zweigeteilten Deutschland. Er schildert die Wandlungen und Brüche in der akademischen Kultur. Im letzten Kapitel schlägt der Autor am Leitfaden seiner religiös-philosophischen Orientierung einen Bogen über das Ganze seines Lebens.
Die Geschichte der Schweiz und der Schweizer hat sich seit Jahren als das Standardwerk zur Schweizer Geschichte etabliert. Von der Prähistorie bis zur Nachkriegszeit bietet das Werk in klarer Sprache und mit zahlreichen Bildern und Grafiken einen fundierten Überblick. 10 ausgewiesene Schweizer Historiker haben ein Werk verfasst, das sich Tag für Tag an Schulen, Universitäten und im privaten Gebrauch bewährt. Als erste Gesamtdarstellung der Schweizer Geschichte räumt die Geschichte der Schweiz und der Schweizer neben der politischen Geschichte auch der Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte breiten Raum ein. Die Studienausgabe der Geschichte der Schweiz und der Schweizer in einem Band erschien erstmals 1986. Sie umfasst den identischen Inhalt in Text und Bild wie die ursprüngliche Ausgabe in drei Bänden. Die nun vorliegende, unveränderte 4. Auflage erscheint in einer verbesserten Ausstattung. Inhaltsübersicht Pierre Ducrey: Vorzeit, Kelten und Römer (bis 401 n.Chr.) Guy P. Marchal: Die Ursprünge der Unabhängigkeit (401-1394) Nicolas Morard: Auf der Höhe der Macht (1394-1536) Martin Körner: Glaubensspaltung und Wirtschaftssolidarität (1515-1648) François de Capitani: Beharren und Umsturz (1648-1815) Georges Andrey: Auf der Suche nach dem neuen Staat (1798-1848) Roland Ruffieux: Die Schweiz des Freisinns (1848-1914) Hans Ulrich Jost: Bedrohung und Enge (1914-1945) Peter Gilg und Peter Hablützel: Beschleunigter Wandel und neue Krisen (seit 1945) Pressestimme Ein historisches Werk, das so wissenschaftlich wie nötig und so verständlich wie möglich geschrieben ist; ein Standardwerk für jeden Eidgenossen. Schweizer Illustrierte
Ob Basler Daig, Fasnacht oder Lällekönig: Persönlich und humorvoll blickt Alain Claude Sulzer auf sein Basel. Augenzwinkernd zeigt er dem Leser, dass sich viele Dinge stetig ändern, das Wesentliche aber erhalten bleibt: Die Stadt am Rhein ist immer in Bewegung. Mit dieser erweiterten Neuauflage ist Sulzers Basel-Buch nun wieder lieferbar. Neu sind auch Hannes Nüsselers extra für dieses Buch angefertigten charmanten und frechen Zeichnungen.