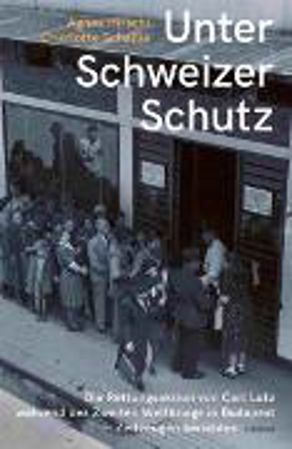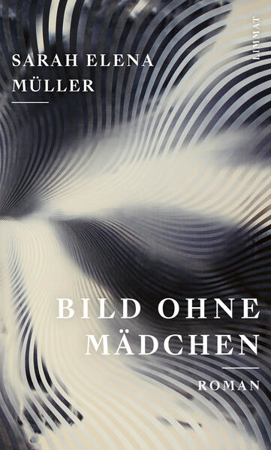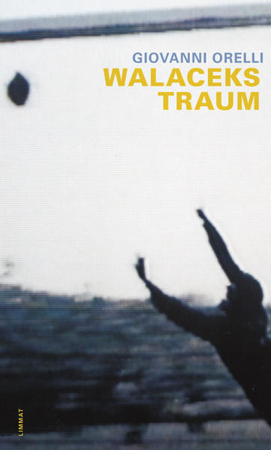Limmat Verlag
Zwischen März 1944 und Januar 1945 leitete der Schweizer Diplomat Carl Lutz (1895-1975) in Budapest eine umfangreiche Rettungsaktion. Lutz und sein Rettungsteam haben schätzungsweise mehr als 50 000 Schutzbriefe ausgestellt und verfolgte Jüdinnen und Juden in 76 sogenannten Schweizer Schutzhäusern untergebracht und damit Zehntausende vor Deportationen, Erschiessungen und Todesmärschen bewahrt. "Unter Schweizer Schutz" enthält Gespräche mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen sowie Berichte, Briefe und Vorträge von Überlebenden in Israel, den Vereinigten Staaten, der Schweiz, Ungarn, Grossbritannien und Kanada. Das Buch zeigt die aussergewöhnliche Reichweite und das Ausmass der humanitären Hilfe von Carl Lutz und erinnert an seine selbstlose Grosstat. Carl Lutz kämpfte sein Leben lang um die staatliche Anerkennung seines Einsatzes, der von der offiziellen Schweiz als "Kompetenzüberschreitung" gewertet wurde. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, war dreimal für den Friedensnobelpreis nominiert und erhielt von Yad Vashem den Ehrentitel "Gerechter unter den Völkern". Im Jahr 2018 wurde im Bundeshaus in Bern ein "Carl Lutz Saal" eingeweiht.
Die fünf Erzählungen der 'Jugend eines Volkes' führen aus mythischem Halblicht über sagenhafte Zwischenstufen, die der dichterischen Fantasie weiten Spielraum gewähren, allmählich hinüber in die Bereiche historisch dokumentierbarer Überlieferung: aus Geschichten wird Geschichte. Der Zyklus setzt ein mit der Sage von Swit und Swen und dem Einzug der Alemannen in den Talkessel von Schwyz. Längst Vertrautes erscheint in völlig neuer, überraschender Beleuchtung. Je reicher die Quellen fliessen, desto dichter werden die Bezüge zu den weltpolitischen Hintergründen, umso zwingender wird die Motivation zur Gründung eines Staates. Im 'Ehrenhaften Untergang' schreitet der sechzigjährige Inglin noch einmal dieselben Räume ab, die er zwanzig Jahre zuvor mit den Gestalten der Vor- und Frühgeschichte bevölkert hatte; diesmal aber gilt sein Augenmerk dem Zerfall jener Ordnungen, die sich im Lauf der Jahrhunderte überlebt hatten. Inglins Darstellung, aufgrund ausgedehnter Quellenstudien erarbeitet, folgt den historischen Tatsachen der verhängnisvollen Maitage von 1798 in erstaunlichem Ausmass, bewahrt sich aber im Einzelnen alle Rechte dichterischer Freiheit.
Ein grossangelegter Familienroman erzählt die Geschichte der Schweizer Neutralität m Ersten Weltkrieg, vom Besuch des deutschen Kaisers in der Schweiz im Jahr 1912 über die Wahl des Obersten Wille zum General im August 1914, die "Oberstenaffäre" von 1916 und den Rücktritt des Bundesrats Hoffmann im Jahre 1917 bis zum Ende des Landesstreiks 1918. Das Oberhaupt der grossbürgerlichen Familie, Nationalrat Ammann, ist der Typus einer zu Ende gehenden Epoche. In seinen drei Söhnen spiegeln sich die Tendenzen der Zeit. Während Severin und Paul nach extremen politischen Richtungen auseinanderstreben, bleibt Fred, der jüngste der Brüder, der mehr und mehr zum Mittelpunkt des Romans wird, in einer gemässigten Mitte. So wird dieses Werk zu einem einzigartigen Zeitdokument, das dank Inglins Meisterschaft auch für heutige Leser nichts von seiner Eindringlichkeit verloren hat.
Die Eltern des Mädchens misstrauen dem Fernsehen, aber beim medienaffinen Nachbarn Ege darf es so lange schauen, wie es will. Eges Wohnung steht voller Geräte, und er dreht Videos, die nie jemand sehen will. Das Mädchen darf in Eges Filmen mitspielen. Hinter der Kamera steht Gisela, seine Part-nerin. Aber meist sitzt Ege in seiner verdunkelten Wohnung, verachtet die Welt und trinkt. Gisela wohnt im oberen Stock und entsorgt die leeren Weinflaschen. Die Eltern sind überfordert mit dem Kind, das sein Bett nässt und kaum spricht. Der Vater ist Biologe und wendet sich lieber bedrohten Tierarten zu. Die Mutter bildhauert und ist mit ihrer Kunst beschäftigt. Ein Heiler soll helfen. Das Mädchen sucht Zuflucht bei einem Engel, den es auf einer Videokassette von Ege entdeckt hat. Und wirklich, der Engel hält zu ihm. Durch dieses Kabinett der Hilf- und Sprachlosigkeit nähert sich Sarah Elena Müller dem Trauma einer Familie, die weder den Engel noch die Gefährdung zu sehen imstande ist. Und von der Grossmutter bis zum Kind entsteht ein Panorama weiblicher Biografien seit dem grossen Aufbruch der Sechzigerjahre.