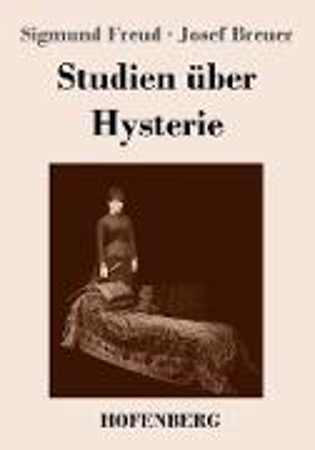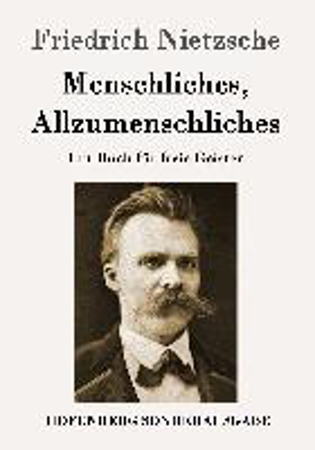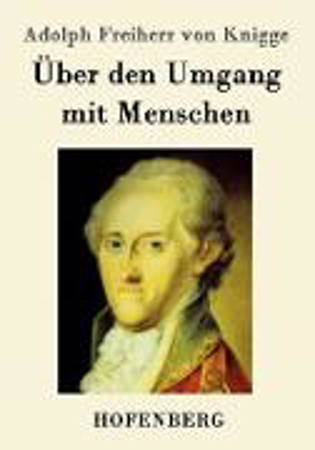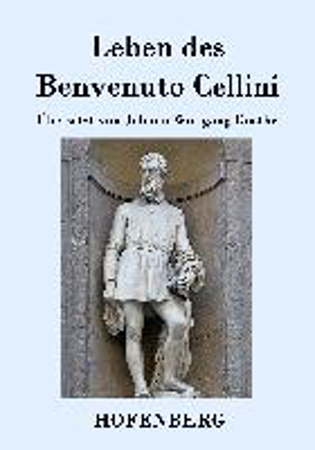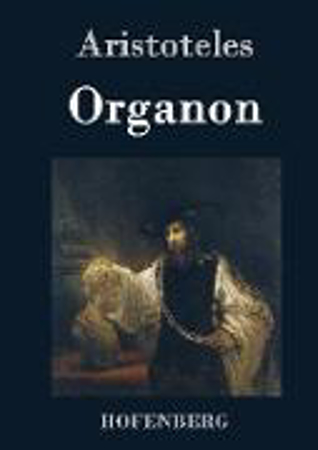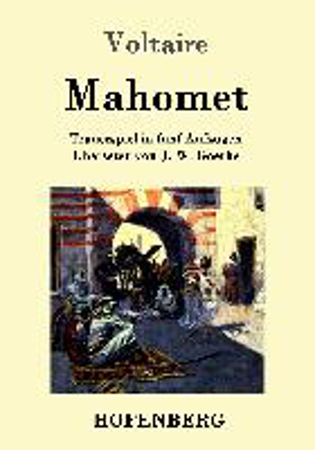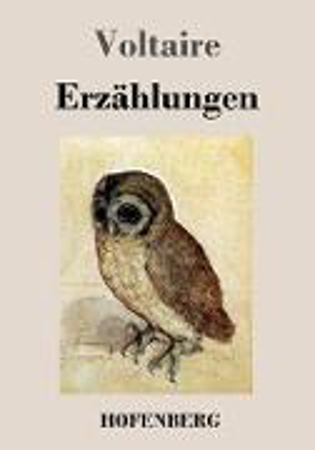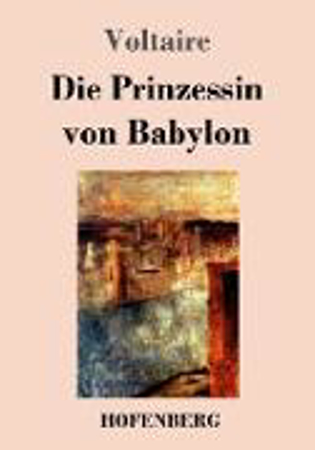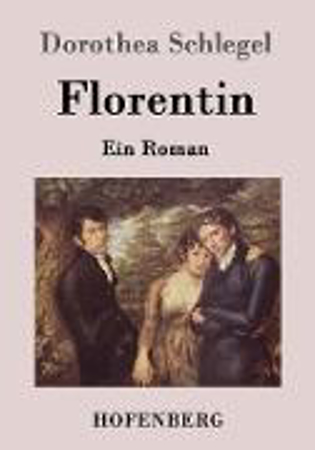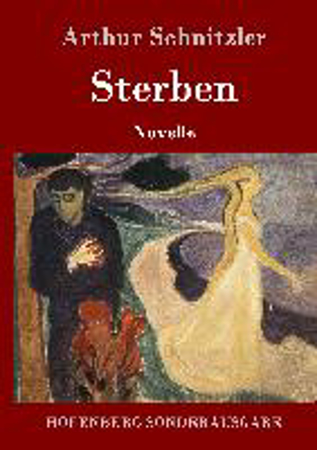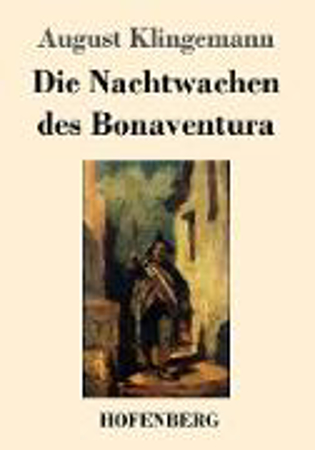Hofenberg
Stefan Zweig: Die Heilung durch den Geist. Mesmer, Mary Baker-Eddy, Freud Erstdruck: Leipzig, Insel, 1931 mit der Widmung »Albert Einstein verehrungsvoll«. Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2017. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Ludwig Feuerbach: Grundsätze der Philosophie der Zukunft und andere Schriften Grundsätze der Philosophie der Zukunft: Erstdruck: Zürich und Winterthur (Julius Fröbel) 1843. Vorläufige Thesen zur Reform der Philosophie: Entstanden 1842. Erstdruck in: Das literarische Comptoir (Zürich und Winterthur) 1843. Über das »Wesen des Christentums« in Beziehung auf den »Einzigen und sein Eigentum«: Erstdruck in: Wigands Vierteljahresschrift (Leipzig), 1845. Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Textgrundlage ist die Ausgabe: Ludwig Feuerbach: Kleine philosophische Schriften (1842-1845). Herausgegeben von Max Gustav Lange, Leipzig: Felix Meiner, 1950 (Philosophische Bibliothek, Bd. 227). Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Johann Gottlieb Fichte: Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre Völlig überraschend wird der zweiunddreissigjährige Fichte im Wintersemester 1794/95 zum Professor der Universität Jena berufen. Goethe, der die Uni beriet, hatte ihn vorgeschlagen. Seine erste Vorlesung zur Wissenschaftslehre hält Fichte ohne ein vollständiges, strukturiertes Manuskript verfasst zu haben, sondern notiert stattdessen vor jedem Termin Hauptgedanken. Daraus entsteht »Die Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre« als Fichtes systematisches Hauptwerk und ein zentraler Text des deutschen Idealismus. Erstdruck: Jena (Gabler) 1794/95; 2. verbesserte Ausgabe: Jena (Gabler) 1802. Der Text folgt der ersten Ausgabe, Veränderungen bzw. Zusätze der 2. Ausgabe erscheinen in den Fußnoten. Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Textgrundlage ist die Ausgabe: Johann Gottlieb Fichtes sämmtliche Werke. Herausgegeben von I. H. Fichte, Band 1-8, Berlin: Veit & Comp., 1845/1846. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
David Hume: Eine Untersuchung über den menschlichen Verstand Das Werk geht auf Überlegungen zurück, die Hume bereits in seinem Jugendwerk »A Treatise of Human Nature« (1739/40) entwickelt hatte. Erstdruck unter dem Titel »Philosophical Essays Concerning Human Understanding«, London 1748. Überarbeitete Fassung unter dem Titel »An Enquiry Concerning Human Understanding« in: David Hume, Essays and Treatises on Several Subjects, 2. Band, London 1758. Erste deutsche Übersetzung durch Johann Georg Sulzer unter dem Titel »Philosophische Versuche über die menschliche Erkenntnis« in: David Hume: Vermischte Schriften über die Handlung, die Manufacturen und die andern Quellen des Reichthums und der Macht eines Staats, 2. Band, Hamburg und Leipzig (Grund & Holle) 1755. Der Text folgt der 2. Ausgabe in der Übersetzung durch Julius Heinrich von Kirchmann von 1869. Bei den gesondert gezählten und mit einem A versehenen Anmerkungen handelt es sich um Zusätze Humes zur Ausgabe in den »Essays«. Vollständige Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Textgrundlage ist die Ausgabe: David Hume: Eine Untersuchung in Betreff des menschlichen Verstandes. Übersetzt, erläutert und mit einer Lebensbeschreibung versehen von J. H. von Kirchmann. Berlin: L. Heimann, 1869 (Philosophische Bibliothek, Bd. 13). Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: David Hume (1766) Porträt von Allan Ramsay. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Gottfried Wilhelm Leibniz: Monadologie. Die erste deutsche Übersetzung von Heinrich Köhler von 1720 »Eclaircissement sur les Monades«, 1714. Hier in der deutschen Übersetzung von Heinrich Köhler, 1720. Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2017. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Christoph Bernhard Francke, Bildnis des Philosophen Gottfried Wilhelm Freiherr von Leibniz, um 1695. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
John Locke: Versuch über den menschlichen Verstand. Die vier Teile in einem Buch Die Ausgabe enthält alle vier Bücher der 1690 erschienen ersten vollständigen Ausgabe. Erstdruck unter dem Titel »An essay concerning human understanding«, London 1690. Erst deutsche Übersetzung durch H. E. Poleyen, Altenburg 1757. Der Text folgt der Übersetzung durch Julius Heinrich von Kirchmann von 1872/73. Inhaltsverzeichnis Versuch über den menschlichen Verstand Widmung Ein Brief an den Leser Erstes Buch. Ueber angeborne Begriffe Zweites Buch. Von den Vorstellungen Drittes Buch. Ueber die Worte Viertes Buch. Ueber Wissen und Meinen Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Textgrundlage sind die Ausgaben: John Locke: Versuch über den menschlichen Verstand. In vier Büchern. Übersetzt und erläutert von J. H. von Kirchmann, Berlin: L. Heimann, 1872 (Philosophische Bibliothek, Bd. 51). Die Paginierung obiger Ausgaben wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Aristoteles: Metaphysik Entstanden zwischen 348 und 322 v. Chr. Erstdruck: Venedig 1498. Erste vollständige deutsche Übersetzung durch Julius Rieckher, Stuttgart 1860. Der Text folgt der Übersetzung durch Adolf Lasson von 1907, der die überlieferten Bücher der »Metaphysik« in folgender Anordnung wiedergegeben hat: II. Buch [¿] S. 1-5. ¿ I. Buch [¿] S. 6-35. ¿ III. Buch [¿] S. 36-57. ¿ IV. Buch [¿] S. 58-84. ¿ VI. Buch [¿] S. 85-92. ¿ VII. Buch [¿] S. 93-130. ¿ VIII. Buch [¿] S. 131-141. ¿ IX. Buch [¿] S. 142-161. ¿ XII. Buch [¿] S. 162-181. ¿ X. Buch [¿] S. 185-206. ¿ XI. Buch [¿] S. 207-236. ¿ XIII. Buch [¿] S. 237-267. ¿ XIV. Buch [¿] S. 267-285. ¿ V. Buch [¿] S. 286-319. Vollständige Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Textgrundlage ist die Ausgabe: Aristoteles: Metaphysik. Ins Deutsche übertragen von Adolf Lasson, Jena: Eugen Diederichs, 1907. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Aristoteles, seine Ethik haltend. Detail aus dem Fresko Die Schule von Athen von Raffael (1510–1511). Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt. Über den Autor: 384 v. Chr. als Sohn des Hofarztes Nikomachos in Stageira in Thrakien geboren, wird Aristoteles Mitglied von Platons »Akademie« in Athen und Lehrer des jungen Alexander (dem Großen), der ihn später in seinen Studien unterstützt. Seine Sytematisierung ist bis heute prägend, er ist neben seinem Lehrer Platon und dessen Lehrer Sokrates der dritte große Philosoph der Antike. Aristoteles stirbt 322 v. Chr. bei Chalkis auf Euböa.
Aristoteles: Nikomachische Ethik Glückseligkeit, Tugend und Gerechtigkeit sind die Gegenstände seines ethischen Hauptwerkes, das Aristoteles kurz vor seinem Tode abschließt. Die »Nikomachische Ethik« entstand vermutlich im letzten Lebensabschnitt von Aristoteles, also in den Jahren vor 322 vor Chr. Erstdruck in lateinischer Übersetzung: Straßburg (vor 10.4.1496). Erstdruck des griechischen Originals: Venedig 1498. Erste vollständige deutsche Übersetzung durch Daniel Jenisch, Danzig 1791. Der Text folgt der deutschen Übersetzung durch Adolf Lasson von 1909. Die Überschriften stammen vom Übersetzer. Vollständige Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016, 2. Auflage. Textgrundlage ist die Ausgabe: Aristoteles: Nikomachische Ethik. Ins Deutsche übertragen von Adolf Lasson, Jena: Eugen Diederichs, 1909. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Hayez, Francesco: Aristoteles. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt. Über den Autor: 384 v. Chr. als Sohn des Hofarztes Nikomachos in Stageira in Thrakien geboren, wird Aristoteles Mitglied von Platons »Akademie« in Athen und Lehrer des jungen Alexander (dem Großen), der ihn später in seinen Studien unterstützt. Seine Sytematisierung ist bis heute prägend, er ist neben seinem Lehrer Platon und dessen Lehrer Sokrates der dritte große Philosoph der Antike. Aristoteles stirbt 322 v. Chr. bei Chalkis auf Euböa.
Franz Werfel: Verdi. Roman der Oper Erstdruck: Wien, Paul Zsolnay Verlag, 1924 Vollständige Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Giovanni Boldini, Portrait von Giuseppe Verdi, 1886. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Wilhelm Busch: Gedichte Kritik des Herzens: Erstdruck: Heidelberg (Bassermann) 1874. Zu guter Letzt: Entstanden: Überwiegend 1898-1899. Erstdruck: München (Bassermann) 1904. Schein und Sein: Entstanden: Zwischen 1899 und 1907. Erstdruck: München (Lothar Joachim) 1909. Vollständige Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2014. Textgrundlage ist die Ausgabe: Wilhelm Busch: Sämtliche Werke, Herausgegeben v. Otto Nöldeke, Band 6, München: Braun & Schneider, 1943. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Gemälde von Franz von Lenbach, um 1875. Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt.
Platon: Parmenides Entstanden vermutlich nach 360 v. Chr. Erstdruck (in lateinischer Übersetzung durch Marsilio Ficino) in: Opere, Florenz o. J. (ca. 1482/84). Erstdruck des griechischen Originals in: Hapanta ta tu Platônos, herausgegeben von M. Musoros, Venedig 1513. Erste deutsche Übersetzung durch Johann Friedrich Kleuker in: Werke, 5. Band, Lemgo 1792. Der Text folgt der Übersetzung durch Franz Susemihl von 1865. Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2017. Textgrundlage ist die Ausgabe: Platon: Sämtliche Werke. Berlin: Lambert Schneider, [1940]. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Raffael, Die Schule von Athen (Detail). Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Johann Gottlieb Fichte: Versuch einer Kritik aller Offenbarung Erstdruck: Königsberg (Hartung) 1792. Veränderungen des Textes in der 2. vermehrte und verbesserte Auflage (Königsberg 1793) sind in den Fußnoten erfaßt. Vollständige Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2013. Textgrundlage ist die Ausgabe: Johann Gottlieb Fichtes sämmtliche Werke. Herausgegeben von I. H. Fichte, Band 1-8, Berlin: Veit & Comp., 1845/1846. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage. Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt.
Johann Gottlieb Fichte: Wissenschaftslehre. Einleitung, Versuch einer neuen Darstellung, allgemeinen Umrisse Erste Einleitung in die Wissenschaftslehre: Erstdruck in: Philosophisches Journal, Bd. 5 (1797), Heft 1, S. 1-47. Veränderung des Textes in der wenig später erschienenen ersten autorisierten Buchausgabe (Jena 1797) sind in den Fußnoten erfaßt. Versuch einer neuen Darstellung der Wissenschaftslehre: Erstdruck in: Philosophisches Journal, Bd. 7 (1797), S. 1-20. Die Wissenschaftslehre, in ihrem allgemeinen Umrisse: Erstdruck: Berlin (J. E. Hitzig) 1810. Vollständige Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2014. Textgrundlage sind die Ausgaben: Johann Gottlieb Fichtes sämmtliche Werke. Herausgegeben von I. H. Fichte, Band 1-8, Berlin: Veit & Comp., 1845/1846. Die Paginierung obiger Ausgaben wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage. Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt.
René Descartes: Prinzipien der Philosophie Erstdruck unter dem Titel »Principia philosophiae«, Amsterdam 1644. Text nach der Übersetzung durch Julius Heinrich von Kirchmann von 1870. Vollständige Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Textgrundlage ist die Ausgabe: René Descartes' philosophische Werke. Übersetzt, erläutert und mit einer Lebensbeschreibung des Descartes versehen von J. H. von Kirchmann, Abteilung I-III, Berlin: L. Heimann, 1870 (Philosophische Bibliothek, Bd. 25/26). Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: René Descartes (Porträt von Frans Hals, 1648). Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt.
Sigmund Freud, Josef Breuer: Studien über Hysterie Die Aufzeichnungen, die der Physiologe Josef Breuer über seine Behandlung der Bertha Pappenheim erstellt, bilden die Grundlage für die Sammlung von Aufsätzen, die er 1895 gemeinsam mit Sigmund Freud veröffentlicht. Freud bezeichnet diesen Text später als Wurzel und Ausgangspunkt der Psychoanalyse. Erstdruck: Leipzig und Wien, Verlag Franz Deuticke, 1895. Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2021. Der Text dieser Ausgabe wurde behutsam an die neue deutsche Rechtschreibung angepasst. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Borwin Borrell, Die Couch, 2021. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt. Henricus - Edition Deutsche Klassik GmbH Über den Autor: 1856 in Freiberg in Mähren als Sohn eines jüdischen Wollhändlers geboren studiert Sigismund Schlomo Freud in Wien Medizin und arbeitet nach kurzen Stationen in der Chirurgie und der Inneren Medizin in Theodor Meynerts psychiatrischer Klinik. 1886 eröffnet er in der Wiener Berggasse 19 seine eigene Praxis, in der sich ein knappes halbes Jahrhundert lang seine Patienten auf die bald schon berühmte Couch legen. Seine neuartigen Vorstellungen von der Bedeutung sexueller Konfliktlagen und von Traumata als Auslöser von Neurosen machen ihn innerhalb und außerhalb der Fachwelt schnell sehr bekannt. Und hochumstritten. Am 23. September 1939 stirbt mit Sigmund Freud der Begründer der Psychoanalyse und einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts in seinem Londoner Exil.
Friedrich Nietzsche: Menschliches, Allzumenschliches. Ein Buch für freie Geister Nietzsches in Aphorismen verfasstes Werk reflektiert seine Krise aus den Jahren 1875 - 1877. Nach dem »Ekel über sich selbst« sieht er sich als »Verräter« der eigenen Ideale, empfindet »Verachtung« gegenüber seinen einstigen Freunden und findet schließlich in der Distanzierung von seiner Vergangenheit den »Freigeist der Gegenwart« als neuen Typus seines Daseins. Erstdrucke: Chemnitz (E. Schmeitzner) 1878 (1. Band); Chemnitz (E. Schmeitzner) 1879 (Anhang: Vermischte Meinungen und Sprüche); ; Chemnitz (E. Schmeitzner) 1880 (Der Wanderer und sein Schatten). Vollständige Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Textgrundlage ist die Ausgabe: Friedrich Nietzsche: Werke in drei Bänden. Band 1, Herausgegeben von Karl Schlechta. München: Hanser, 1954. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Friedrich Nietzsche, Fotografie von F. Hartmann, um 1875. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Adolph Freiherr von Knigge: Über den Umgang mit Menschen »Wenn die Regeln des Umgangs nicht bloß Vorschriften einer konventionellen Höflichkeit oder gar einer gefährlichen Politik sein sollen, so müssen sie auf die Lehren von den Pflichten gegründet sein, die wir allen Arten von Menschen schuldig sind, und wiederum von ihnen fordern können. ¿ Das heißt: Ein System, dessen Grundpfeiler Moral und Weltklugheit sind, muss dabei zum Grunde liegen.« Adolph Freiherr von Knigge Erstdruck: Hannover (Schmidt) 1788. Hier nach der 3., erweiterten Auflage, 1790. Vollständige Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2013. Textgrundlage ist die Ausgabe: Adolph Freiherr von Knigge: Über den Umgang mit Menschen. Herausgegeben von Gert Ueding, Frankfurt a.M.: Insel, 1977. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage. Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt. Über den Autor: 1752 in Bredenbeck bei Hannover geboren, erbt Adolph Franz Friedrich Ludwig Freiherr von Knigge nach dem Tode seines Vaters Schulden von über 100.000 Reichstalern. Er wird Direktor einer Tabakfabrik, Kammerherr von Herzog Carl August von Sachsen-Weimar und gründet ein Liebhabertheater. Knigge tritt dem Illuminatenorden bei und wird Freimaurer der Loge »Zum gekrönten Löwen«. Er schreibt Theaterstücke, Romane, Sonaten und eine ganze Reihe theoretischer Abhandlungen, deren heute mit Abstand bekannteste die untrennbar mit seinem Namen verbundene Schrift »Über den Umgang mit Menschen« ist.
Maria Leitner: Hotel Amerika
Erstdruck: Berlin, Neuer Deutscher Verlag, 1930.
Neuausgabe.
Herausgegeben von Karl-Maria Guth.
Berlin 2017.
Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Edgar Degas, Plätterinnen (Ausschnitt), 1884.
Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Arno Holz, Johannes Schlaf: Die Familie Selicke. Drama in drei Aufzügen Das bahnbrechende Stück für das naturalistische Drama soll den Zuschauer »in ein Stück Leben wie durch ein Fenster« blicken lassen. Arno Holz, der »die Familie Selicke« 1889 gemeinsam mit seinem Freund Johannes Schlaf geschrieben hat, beschreibt konsequent naturalistisch, durchgehend im Dialekt der Nordberliner Arbeiterviertel, der Holz aus eigener Erfahrung sehr vertraut ist, einen Weihnachtsabend der 1890er Jahre im kleinbürgerlich-proletarischen Milieu. Erstdruck: Berlin (Wilhelm Issleib [Gustav Schuhr]), 1890. Uraufführung am 7.4.1890 in Berlin (Freie Bühne). Vollständige Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2015. Textgrundlage ist die Ausgabe: Naturalismus ¿ Dramen. Lyrik. Prosa. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Ursula Münchow, Band 1: 1885¿1891, Berlin und Weimar: Aufbau, 1970. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Nicolae Grigorescu: Zwei Betrunkene (Ausschnitt), 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt. Über den Autor: 1863 in Ostpreußen als Apothekersohn geboren, 1875 nach Berlin übergesiedelt, bricht Arno Holz die Schule ohne Abschluss ab und lebt als freier Schriftsteller in wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen im Berliner Wedding. Seine Lyrik entwickelt sich ab 1885 um die soziale Frage herum, er tritt dem naturalistischen Literaturverein »Durch!« bei und wird in der literarischen Avantgarde, die ihn trotz junger Jahre halb liebevoll, halb spöttisch »Papa Holz« nennt, ein ebenso aktiver wie sendungsbewußter Mann. »Kunst=Natur-X« ist die Formel, auf die Holz das Ziel künstlerischen Schaffens bringt. 1887 zieht er mit seinem Freund Johannes Schlaf zusammen und schreibt gemeinsam mit ihm unter dem Pseudonym Bjarne P. Holmsen eine Reihe naturalistischer Werke bis sie sich über die Aufteilung der kargen Honorare in einem öffentlich geführten Streit entzweien. Er erhält die Ehrendoktorwürde der Universität Königsberg, wird Mitglied der Preußischen Akademie der Künste zu Berlin und als Kandidat für den Literatur-Nobelpreis nominiert. Alfred Döblin schreibt über Arno Holz: »Er war bis zuletzt eine Lehrernatur, ein Mann, der etwas bestimmt wußte und es demonstrierte.« Arno Holz starb am 26.10.1929 in Berlin.
Wilhelm Raabe: Holunderblüte / Das letzte Recht. Zwei Erzählungen Holunderblüte: Entstanden zwischen November 1862 und Januar 1863. Ursprünglicher Titel: »Ein Ballkranz«. Das letzte Recht: Entstanden im Februar 1862. Ertdruck in »Westermann's illustrirten deutschen Monats-Heften«, 1862. Vollständige Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2015. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Childe Hassam, Blüten, 1883. Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt. Über den Autor: 1831 in Eschershausen im Weserland als Sohn eines Juristen geboren, bricht Wilhelm Raabe die Schule erfolglos ab, beginnt eine ebenfalls bald wieder aufgegebene Buchhändlerlehre und widmet sich umfangreicher Romanlektüre. 1854 beginnt er die Arbeit an dem Roman »Die Chronik der Sperlingsgasse«, die er 1856 unter dem Pseudonym »Jakob Corvinus« veröffentlicht. Ab 1857 erscheinen seine historischen Erzählungen in »Westermanns Monatsheften«. Nach zahlreichen ausgedehnten Reisen durch Deutschland übersiedelt Raabe nach Stuttgart und tritt u.a. dem »Deutschen Nationalverein« und dem »Großen Klub« bei. 1866 ist er an der Gründung der liberalen »Deutschen Partei« beteiligt. 1897 erscheint eine erste Monographie über Raabe und zu seinem 70. Geburtstag 1901 erhält der inzwischen verehrte Dichter mehrere hundert Glückwunschschreiben. Mit den Ehrendoktorwürden der Universitäten Göttingen, Tübingen und Berlin und dem Königlich Preußischen Kronenorden ausgezeichnet, erkrankt Wilhelm Raabe 1909 schwer und stirbt 1910 als Ehrenmitglied der Deutschen Schiller-Stiftung in Braunschweig. Wilhelm Raabe ist neben Theodor Fontane einer der großen Vertreter des poetischen Realismus. Seine plastischen Darstellungen realistischer Bildlichkeit sind mit seiner Sympathie für Außenseiter humoristisch stimmungsvoll. »Die Figuren meiner Bücher sind sämtlich der Fantasie entnommen; nur selten ist das Landschaftliche nach der Natur gezeichnet. Das Volkstümliche fasse ich instinktiv auf.«
Iwan Turgenjew: Aus der Jugendzeit. Drei Erzählungen
Erstdruck dieser Übersetzung von Adolf Gerstmann: Berlin, 1887. Die Rechtschreibung wurde für die vorliegende Neuausgabe behutsam modernisiert.
Inhaltsverzeichnis
Aus der Jugendzeit
Telegin und Pawlowna
Iwan Suchich
Der Verzweifelte
Neuausgabe mit einer Biographie des Autors.
Herausgegeben von Karl-Maria Guth.
Berlin 2017.
Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Unbekannter Künstler, Illustration eines russichen Märchenbuches, um 1900.
Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Friedrich Glauser: Die Speiche. Wachtmeister Studer. Fünfter Roman Erstdruck vom 15.9.1937 bis zum 15.1.1938 in der Zeitschrift »Schweizerische Beobachter« unter dem Titel »Krock & Co.«. Erste Buchausgabe 1941 im Morgarten-Verlag, Zürich. Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Heinrich Gretler als »Wachtmeister Studer« im gleichnamigen Film aus dem Jahre 1939. Foto: Emil Berna / Praesens-Film AG / CC BY-SA 4.0. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gretler_Studer2.jpg Hier leicht farbverändert wiedergegeben.. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
E. T. A. Hoffmann: Meister Floh. Ein Märchen in sieben Abenteuern zweier Freunde Als einen humoristischen Autoren beschreibt sich E.T.A. Hoffmann in Verteidigung seines von den Zensurbehörden beschlagnahmten Manuskriptes, der »die Gebilde des wirklichen Lebens nur in der Abstraction des Humors wie in einem Spiegel auffassend reflectirt«. Es nützt nichts, die Episode um den Geheimen Hofrat Knarrpanti, in dem sich der preußische Polizeidirektor von Kamptz erkannt haben will, fällt der Zensur zum Opfer und erscheint erst 90 Jahre später. Das gegen ihn eingeleitete Disziplinarverfahren, der Jurist Hoffmann ist zu dieser Zeit Mitglied des Oberappellationssenates am Berliner Kammergericht, erlebt er nicht mehr. Er stirbt kurz nach Erscheinen der zensierten Fassung seines »Märchens in sieben Abenteuern«. Erstdruck: Frankfurt/M. (Willmanns) 1822. Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Textgrundlage ist die Ausgabe: E.T.A. Hoffmann: Poetische Werke in sechs Bänden, Band 6, Berlin: Aufbau, 1963. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Jan Verkolje, Anthonie van Leeuwenhoek, um 1680. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt. Über den Autor: 1776 in Königsberg auf die Vornamen Ernst Theodor Wilhelm getauft, nennt er sich später aus Verehrung für Mozart Ernst Theodor Amadeus oder kurz E.T.A. Hoffmann. Er studiert Jura in Königsberg, wird Referendar am Berliner Kammergericht, wegen Karikaturen auf preußische Offiziere strafversetzt nach Polen und schließlich Kapellmeister in Bamberg. Bis er 1814 nach Berlin zurückkehrt widmet er sein künstlerisches Schaffen vornehmlich der Musik. Er wird zum Kammergerichtsrat berufen, gründet den »Serapinenorden« und schreibt seine großen Romane, »Die Elixiere des Teufels« und die »Lebensansichten des Katers Murr«, sowie zahlreiche Erzählungen, deren vorletzte, der »Meister Floh«, beschlagnahmt wird, weil der preußische Polizeidirektor in der Figur des Knarrpanti eine Satire auf seine Person sieht. 1822 erkrankt E.T.A. Hoffmann schwer und diktiert - völlig gelähmt - vom Sterbebett aus die Erzählung »Des Vetters Eckfenster«, in der der große Romantiker sich dem kritischen Realismus annähert bevor er am 25. Juni in Berlin stirbt.
Benvenuto Cellini: Leben des Benvenuto Cellini, florentinischen Goldschmieds und Bildhauers. Von ihm selbst geschrieben Geschrieben zwischen 1557 und 1566. Erstdruck 1728. Hier in der Übersetzung von Johann Wolfgang Goethe, 1798. Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Benvenuto Cellini: Leben des Benvenuto Cellini, florentinischen Goldschmieds und Bildhauers. Von ihm selbst geschrieben Geschrieben zwischen 1557 und 1566. Erstdruck 1728. Hier in der Übersetzung von Johann Wolfgang Goethe, 1798. Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Else Ury: Nesthäkchen Gesamtausgabe in zwei Bänden. Erster Band: Nesthäkchen und ihre Puppen / Nesthäkchens erstes Schuljahr / Nesthäkchen im Kinderheim / Nesthäkchen und der Weltkrieg / Nesthäkchens Backfischzeit
Nesthäkchen und ihre Puppen:
Nesthäkchen Band 1. Erstdruck Meidinger's Jugendschriften Verlag, Berlin, 1913.
Nesthäkchens erstes Schuljahr:
Nesthäkchen Band 2. Erstdruck Meidinger's Jugendschriften Verlag, Berlin, 1915.
Nesthäkchen im Kinderheim:
Nesthäkchen Band 3. Erstdruck Meidinger's Jugendschriften Verlag, Berlin, 1915.
Nesthäkchen und der Weltkrieg:
Nesthäkchen Band 4. Erstdruck Meidinger's Jugendschriften Verlag, Berlin, 1916.
Nesthäkchens Backfischzeit:
Nesthäkchen Band 5. Erstdruck Meidinger's Jugendschriften Verlag, Berlin, 1920.
Neuausgabe.
Herausgegeben von Karl-Maria Guth.
Berlin 2016.
Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Pierre-Auguste Renoir, Mädchen mit Gießkanne, 1876.
Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Aristoteles: Organon Das »Organon« ist die aus verschiedenen Einzelschriften zusammengesetzte Logik des Aristoteles. Die Schriften entstanden vermutlich zwischen 367 und 344 v. Chr. Sowohl der Titel als auch die Zusammenstellung gehen nicht unmittelbar auf Aristoteles zurück, sondern sind der peripatetischen Schultradition zuzuschreiben, vielleicht dem Herausgeber Andronikos aus Rhodos, 1. Jh. v. Chr. Inhaltsverzeichnis Organon Kategorien oder Lehre von den Grundbegriffen Hermeneutika oder Lehre vom Urtheil Erste Analytiken oder Lehre vom Schluss Zweite Analytiken oder Lehre vom Erkennen Die Topik Ueber die sophistischen Widerlegungen Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016, 2. Auflage. Textgrundlage sind die Ausgaben: Aristoteles: Kategorien oder Lehre von den Grundbegriffen. Aristoteles: Hermeneutica oder Lehre vom Urtheil. Übersetzt und erläutert von J. H. von Kirchmann, Leipzig: Erich Koschny, 1876 (Philosophische Bibliothek, Bd. 70). Aristoteles: Erste Analytiken oder: Lehre vom Schluss. Übersetzt und erläutert von J. H. von Kirchmann, Leipzig: Felix Meiner, o. J. (Philosophische Bibliothek, Bd. 10). Aristoteles: Zweite Analytiken oder: Lehre vom Erkennen. Übersetzt und erläutert von J. H. von Kirchmann, Leipzig: Felix Meiner, o. J. (Philosophische Bibliothek, Bd. 10). Aristoteles: Die Topik. Übersetzt und erläutert von J. H. von Kirchmann, Heidelberg: Georg Weiss, 1882 (Philosophische Bibliothek, Bd. 89). Aristoteles: Sophistische Widerlegungen. Übersetzt und erläutert von J. H. von Kirchmann, Heidelberg: Georg Weiss, 1883 (Philosophische Bibliothek, Bd. 91). Die Paginierung obiger Ausgaben wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Rembrandt: Aristoteles vor der Büste des Homer, 1653. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt. Über den Autor: 384 v. Chr. als Sohn des Hofarztes Nikomachos in Stageira in Thrakien geboren, wird Aristoteles Mitglied von Platons »Akademie« in Athen und Lehrer des jungen Alexander (dem Großen), der ihn später in seinen Studien unterstützt. Seine Sytematisierung ist bis heute prägend, er ist neben seinem Lehrer Platon und dessen Lehrer Sokrates der dritte große Philosoph der Antike. Aristoteles stirbt 322 v. Chr. bei Chalkis auf Euböa.
Voltaire: Mahomet. Trauerspiel in fünf Aufzügen »Le fanatisme ou Mahomet le Prophète«. Uraufführung 1741 in Lille. Erstdruck 1742 in Brüssel. Deutscher Erstdruck in einer anonymen Übersetzung Braunschweig, 1748. Hier in der Übersetzung und Bearbeitung von Johann Wolfgang Goethe, Cotta, Tübingen 1802. Vollständige Neuausgabe. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2015. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Charles Russell, Arabische Straßenszene, 1908. Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt.
Voltaire: Erzählungen Übersetzung von Wilhelm Christhelf Siegmund Mylius aus der Werkausgabe in 26 Bänden, Berlin, Arnold Wever, 1786-1794 in originalgetreuer Rechtschreibung. Inhaltsverzeichnis Erzählungen I. Der wakre Bramine II. Die Blinden, die über die Farben urtheiten III. Wie gefärlich es ist, Recht zu haben IV. Reise nach dem Himmel V. Eine Arabische und Eine Indische Erzälung VI. Der Uhu und die Vögel VII. Bababek ober die Fakire VIII. Andre Zeiten, andre Meinungen! IX. Der König von Baton X. Die beiden Getrösteten XI. Timon XII. Von dem, was man nicht thut XIII. Pythagoras in Indien XIV. Pater Fouquet und sein Schirmling XV. Plato's Traum XVI. Die Kontroversisten XVII. Wie apostolisch die Bischöfe leben Vollständige Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2015. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Albrecht Dürer, Die kleine Eule, 1506. Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt.
Voltaire: Die Prinzessin von Babylon La Princesse de Babylone, Genf, 1768. Hier in der Übersetzung von Wilhelm Christhelf Siegmund Mylius aus der Werkausgabe in 26 Bänden, Berlin, Arnold Wever, 1786-1794. Vollständige Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2015. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Edgar Degas, Seramis erbaut Babylon (Ausschnitt), 1861. Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt.
Sophie von La Roche: Geschichte des Fräuleins von Sternheim Der empfindsame Briefroman gilt als erster von einer Frau geschriebener Roman in deutscher Sprache. Christoph Martin Wieland, mit dem La Roche zuvor verlobt war, gab den Roman 1771 mit einem Vorwort heraus und rühmt darin die »ungeschminkte Aufrichtigkeit der Seele« und die »Wahrheit und Schönheit der moralischen Schilderung«. Erstdruck (anonym): Leipzig (Weidmanns Erben und Reich) 1771. Vollständige Neuausgabe mit einer Biographie der Autorin. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2015. Textgrundlage ist die Ausgabe: Sophie von La Roche: Geschichte des Fräuleins von Sternheim. Von einer Freundin derselben aus Original-Papieren und anderen zuverlässigen Quellen gezogen. Herausgegeben von C.M. Wieland. Vollständiger Text nach der Erstausgabe von 1771. Herausgegeben von Günter Häntzschel, München: Winkler, 1976. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Johann Friedrich Bury, Gräfin Luise von Voss, 1810. Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt.
Dorothea Schlegel: Florentin Der junge Vagabund Florin kann dem Grafen Schwarzenberg während einer Jagd das Leben retten und begleitet ihn als Gast auf sein Schloß. Dort lernt er Juliane, die Tochter des Grafen, kennen, die aber ist mit Eduard von Usingen verlobt. Ob das gut geht? Erstdruck (anonym), herausgegeben von Friedrich Schlegel: Lübeck (Bohn) 1801. Die geplante Fortsetzung ist nicht erschienen und wurde wohl auch nicht geschrieben. Vollständige Neuausgabe mit einer Biographie der Autorin. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2013. Textgrundlage ist die Ausgabe: Dorothea Schlegel: Florentin. Roman. Fragmente. Varianten. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Liliane Weissberg, Berlin: Ullstein, 1987. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Philipp Otto Runge, Wir drei, 1805. Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt.
Maurice Leblanc: Die Dame mit den grünen Augen. Ein Abenteuer des Arsène Lupin
La Demoiselle aux yeux verts. Erstdruck: 1927. Hier in der Übersetzung von Hans Jacob, Berlin, Schreiter, 1927.
Neuausgabe.
Herausgegeben von Karl-Maria Guth.
Berlin 2016.
Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage.
Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Arthur Schnitzler: Sterben. Novelle Erstdruck: Neue Deutsche Rundschau, V. Jahrgang, 10. Bis. 12. Heft, Oktober¿Dezember 1894. Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2016. Textgrundlage ist die Ausgabe: Arthur Schnitzler: Gesammelte Werke. Die erzählenden Schriften, 2 Bände, Frankfurt a.M.: S. Fischer Verlag, 1961. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Edvard Munch, Trennung, 1896. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt. Über den Autor: 1862 in eine begüterte, jüdische Arztfamilie in Wien hineingeboren studiert Arthur Schnitzler selbst Medizin und betreibt nach kurzen Krankenhausjahren eine Privatpraxis, die er mit zunehmender literarischer Tätigkeit immer weiter reduziert. Er lernt Sigmund Freud kennen und begeistert sich für dessen Studien zum Un- und Unterbewußten. Gemeinsam mit Hugo von Hofmannsthal gilt er als Kern der »Wiener Moderne« und ist einer der bedeutendsten Kritiker seiner Zeit. Mit der Novelle »Leutnant Gustl« führt er den inneren Monolog, die seinen Figuren assoziative Reaktionen auf ihre Umwelt ermöglichen, in die deutsche Literatur ein. Seine Montagetechnik verwebt Klischees und vermeintlich individuelle Reaktionen zu einem überindividuellen Typus. Egoistische Flucht vor Verantwortung und Bindungsängste sind zentrale Themen seines umfangreichen Werkes. Nachdem ihm 1921 nach einem Skandal um seinen »Reigen« die Aufführungsgenehmigung entzogen wird, ernennt ihn der österreichische PEN-Clubs 1923 zu seinem Präsidenten. Drei Jahre später erhält er den Burgtheaterring und gehört zu den meistgespielten Dramatikern auf deutschen Bühnen als er 1931 in Wien an einer Gehirnblutung stirbt.
Jeremias Gotthelf: Anne Bäbi Jowäger. Wie Anne Bäbi Jowäger haushaltet und wie es ihm mit dem Doktern geht
Erstdruck in zwei Teilen, Solothurn, Jent und Gassmann, 1843/44.
Neuausgabe mit einer Biographie des Autors.
Herausgegeben von Karl-Maria Guth.
Berlin 2017.
Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Franz Anton Maulbertsch, Der Quacksalber, 1785.
Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Mark Aurel: Meditationen. Selbstbetrachtungen
Entstanden vermutlich zwischen 170 und 178 n. Chr. unter dem Titel »Tôn eis heauton biblia« (Die Bücher der Gedanken über sich selbst). Erstdruck, herausgegeben von W. Xylander: Zürich 1558 (1559?). Erste deutsche Übersetzung (in Versen) durch P. Stolte unter dem Titel »Allgemeiner Tugendspiegel oder Kern moralischer Gedanken Marci Aurelii Antonini Philosophi von und an sich selbst«: Rostock 1701.
Vollständige Neuausgabe mit einer Biographie des Autors.
Herausgegeben von Karl-Maria Guth.
Berlin 2016.
Textgrundlage ist die Ausgabe:
Mark Aurel's Meditationen. Aus dem Griechischen von F. C. Schneider. Dritte verbesserte Auflage, Breslau: Eduard Trewendt, 1875.
Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt.
Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Barnos, Kopf einer Büste des Marcus Aurelius, London, British Museum, Fotografie von 2015. Unveränderte Wiedergabe. CC-BY-SA 3.0. Das Bild ist unter der Creative-Commons-Lizenz »Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland« lizenziert. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.de.
Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Anatole France: Die Insel der Pinguine
»L'Île des Pingouins«. Erstdruck: Paris, 1908. Hier in der Übersetzung von Paul Wiegler, München, Piper, 1909.
Neuausgabe.
Herausgegeben von Karl-Maria Guth.
Berlin 2020.
Der Text dieser Ausgabe wurde behutsam an die neue deutsche Rechtschreibung angepasst.
Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Wilhelm Kuhnert, Goldschopfpinguine.
Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt.
Stefan Zweig: Drei Dichter ihres Lebens. Casanova, Stendhal, Tolstoi
Erstdruck: Insel, Leipzig 1928. Die Baumeister der Welt. Versuch einer Typologie des Geistes, Band 3. Maxim Gorki gewidmet.
Vollständige Neuausgabe.
Herausgegeben von Karl-Maria Guth.
Berlin 2015.
Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Casanova, Stendhal, Tolstoi. Tim Tempelhofer, 2015.
Gesetzt aus Minion Pro, 11 pt.
August Klingemann: Die Nachtwachen des Bonaventura Erst 1987 belegte eine in Amsterdam gefundene Handschrift Klingemann als Autor dieses vielbeachteten und hochgeschätzten Textes. In sechzehn Nachtwachen erlebt »Kreuzgang«, der als Findelkind in einem solchen gefunden und seither so genannt wird, die »absolute Verworrenheit« der Menschen und erkennt: »Eins ist nur möglich: entweder stehen die Menschen verkehrt, oder ich. Wenn die Stimmenmehrheit hier entscheiden soll, so bin ich rein verloren.« Erstdruck: Nachtwachen. Von Bonaventura, Penig (F. Dienemann) 1805. Neuausgabe mit einer Biographie des Autors. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin 2017. Textgrundlage ist die Ausgabe: August Klingemann: Nachtwachen von Bonaventura. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Jost Schillemeit, Frankfurt a.M.: Insel, 1974. Die Paginierung obiger Ausgabe wird in dieser Neuausgabe als Marginalie zeilengenau mitgeführt. Umschlaggestaltung von Thomas Schultz-Overhage unter Verwendung des Bildes: Carl Spitzweg, Der Nachtwächter, 1871. Gesetzt aus der Minion Pro, 11 pt. Über den Autor: 1777 in Braunschweig geboren, schreibt Klingemann - noch während er das Collegium Carolinum besucht - im Alter von 18 Jahren erste Bühnenstücke und Romane. Als er 1798 das Studium der Rechtswissenschaften in Jena aufnimmt, hat er bereits drei größere Werke veröffentlicht. Gemeinsam mit Clemens Brentano gründet er die Zeitschrift »Memnon«, verfasst zahlreiche weitere Bühnenstücke, ist kurzzeitig Professor am Collegium Carolinum und wird schließlich Theaterdirektor des Braunschweiger Nationaltheaters als er 1831 in Braunschweig stirbt. 1804 veröffentlicht Klingemann unter dem Pseudonym »Bonaventura« den Roman »Nachtwachen«, die sein berühmtestes Werk werden sollten, auch weil die Frage der Autorenschaft die germanistische Forschung bis in die 1980er Jahre hinein beschäftigt hat.