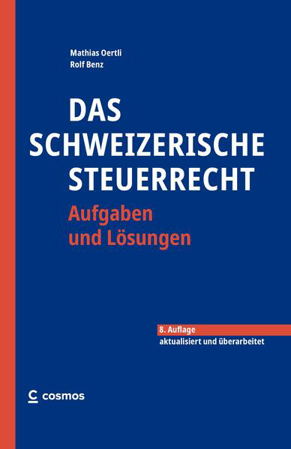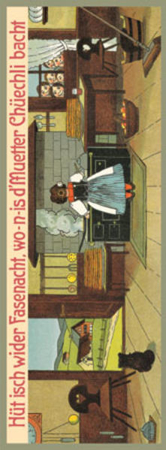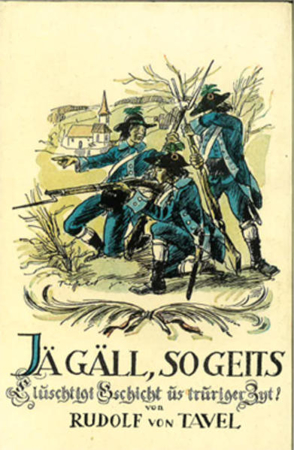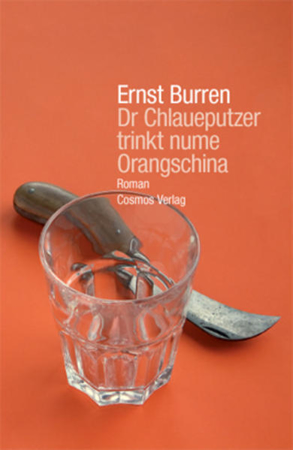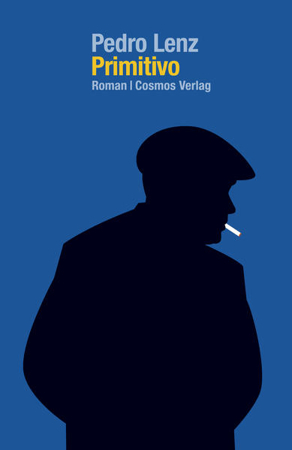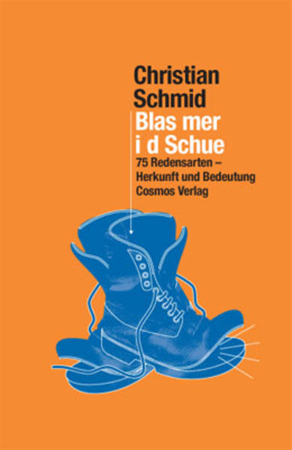Cosmos
Drei Künstler und Tagediebe stolpern in dieser tragisch-komischen Geschichte durch das neblige Olten: Jackpot, der erfolglose Schriftsteller, der auf Hunde und Pferde wettet, und die beiden Maler Louis und Grunz, die das Leben und die Schönheit lieben. Ihre Hingabe zur Kunst und zu den kleinen Freuden des Alltags scheint die drei Freunde zu erfüllen. Das Schicksal meint es gut mit denen, die wenig verlangen und viel geben. Doch dann tritt die schöne Fanny in ihr Leben. Allein durch ihre Präsenz bringt Fanny das scheinbar stabile Gleichgewicht der Männerfreundschaft ins Wanken. Mit der Leichtigkeit des Seins ist es bald vorbei. Jeder begehrt Fanny, aber keiner scheint zu verstehen, was Fanny begehrt.
Um den Studierenden und auch weiteren interessierten Kreisen die Repetition des Steuerrechts zu erleichtern, wird als hilfreiche Ergänzung zum bekannten Standardwerk «Das schweizerische Steuerrecht - Ein Grundriss mit Beispielen» ein praxisnahes Aufgabenbuch mit kurzen Fallbeispielen und Lösungshinweisen angeboten. Das Aufgabenbuch folgt im Aufbau dem Hauptwerk und stellt dadurch eine wertvolle Ergänzung für den Unterricht und für das Selbststudium dar. Die Fragen und kurzen Fallbeispiele decken das gesamte schweizerische Steuerrecht ab. Um den Praxisbezug zu verstärken, sind ausgewählte Formulare in die Aufgaben integriert. Die vorliegende 8. Auflage des Aufgabenbuches ist abgestimmt auf die 11. Auflage des Standardwerkes. Mit der Kombination Hauptwerk und Aufgabenbuch mit Lösungshinweisen steht dem Leser ein aktuelles, sehr umfassendes Arbeitsinstrument zur Verfügung. Die beiden Bücher werden auch als Set angeboten (ISBN 978-3-85621-262-9).
"Was ist das für eine Gesellschaft, in der alle etwas über das Unterhöschen von Britney Spears wissen, aber nichts über ihren Nachbarn?", fragt Pedro Lenz in einem Interview mit der Aargauer Zeitung. Seine Geschichten handeln von diesen Nachbarn, er erzählt mit Zuneigung von ihnen, von ihren Stärken und ihren Schwächen, von der Sehnsucht nach Liebe und von den Tücken des Alltags.